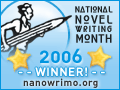30.11.2006
Es ist geschafft ...
24.11.2006
In Stuttgart wäre das nicht passiert! (auch: Was ist Kritik?)
"Vor Auto gelegtes Baby ist in Berlin gestorben"
Noch Fragen?
NaNoWriMo
Mit all der Arbeit, die ich zur Zeit habe, stand meine Teilnahme am NaNoWriMo in den Sternen. Doch obwohl ich eigentlich eher selten an meinem Text weiter gearbeitet habe, bin ich innerhalb von zwanzig Tagen auf die stolze Summe von 42.000 Wörtern gekommen.
Wer klopft mir auf die Schulter?
Meine Fähigkeit, ...
bestimmte Menschen mit meiner Textkritik zu verärgern, ist in letzter Zeit in die Tiefe und die Breite gewachsen.
Da wirft mir doch ein R. vor, ich habe keine Ahnung von Kritik und meine Kommentare seien unbegründet. - An dieser Stelle dürfte sich zum Beispiel Alice einschalten, die das, glaube ich, anders sieht.
Diesem R. verdanken wir also solche hervorragenden Sätze wie:
... Langsam atmete er, zwang sich, langsam zu atmen, versuchte, nicht an das zu denken, wovor er hierhin geflüchtet war.
Voller Wut trat er einen Stein beiseite, wollte ihn zersprengen nur mit der Kraft seines glühenden Hasses, seiner Gedanken um sein personifiziertes Leid. Warum nur tat er sich das an? ...
... Tränen quollen Roland aus den roten Augen, er wollte hassen, musste hassen, um sich selbst zu schützen, konnte nicht hassen. Sein schlanker Körper fiel zu Boden, ja, genau das hatte er jetzt gebraucht; er wand sich lüstern in seinem Schmerz, ...
... Schreiend, schluchzend kniete er, hämmerte mit den Fäusten gegen seinen Bauch, wollte nur noch Schmerzen spüren, es sollte ihn zerreißen vor Agonie. Ja! Das tat so gut, wundervoll! ...
Auf meine Kommentare, die sich unter anderen um Warnungen vor zu viel Passivkonstruktionen drehten, schrieb der werte junge Mann dann Folgendes:
außerdem: deine art zu kritisieren ist schrecklich. an den anfang und an den schluss setzt man positives, generell sollte das positive überwiegen
dem würde ich zustimmen: wenn man einen Text schreibt, lieber R., sollte das Positive überwiegen: schön, dass du das einsiehst
(ich weiß, das kann oft schwer fallen, davon genug zu finden,
stimmt!
man sollte es aber zumindest redlich versuchen, wenn man wirklich "kritisieren" will - denn kritisieren heißt beurteilen und feedback geben, nicht verzweifelt versuchen zu zerstören).
Das ist fein! Alle meine Freunde wissen, wie ich verzweifelt zuhause sitze und versuche, etwas kaputt zu machen. Aber selbst dazu scheine ich dann doch zu dumm zu sein und muss mich, wie man richtig zu kritisieren hat, von einem 18jährigen vorführen lassen.
natürlich, das ganze ist nur dein subjektiver eindruck, vielleicht hattest du einfach nur einen schlechten tag und wolltest das am erstbesten opfer - das dann eben ich war - auslassen;
Hübsch, wie rasch hier von der Sachebene auf die Projektion umgeschwenkt wird. - Gut, ich war nicht sonderlich nett zu diesem R.: ich habe ihm dann, im Fazit, folgendes geschrieben: "Dein Text ist kaum eine Geschichte zu nennen, eher ein Aneinanderkleben von großen Worten. Handlungen, die nicht das immer gleiche benennen, neue Ideen, Wandlungen, schöne Sprache, all das fehlt." Nett ist das nicht. Aber angesichts der Sätze, die ich oben aus seinem Text zitiert habe, einfach nur angebracht.
R+ (Au-délà du marché) - man lese hier durchaus die Aufforderung: "Erblüh!" (er-plus auf französisch) und darin den Befehl, dass ein Wort seine Metaphorizität preis gibt
Besonders lustig wird R. aber in dem Moment, wenn er dann dies schreibt:
nur zerstörst du damit zum einen deine glaubwürdigkeit (das egoistische motiv) und zum anderen möglicherweise die motivation anderer, zu schreiben (das moralisch-altruistische motiv).
Hat jemand diesen Satz verstanden?
Ich nicht!
Was hat denn Glaubwürdigkeit in diesem Fall mit egoistischen Motiven zu tun?
Und das altruistische Motiv besteht für mich auch darin, solche Texte der Leserwelt zu ersparen, wie dieser Herr sie schreibt. Da finde ich mich doch wirklich altruistisch.
Wollt ihr noch mehr?
Bitte:
Ich schrieb dann zurück:
und ich sehe insgesamt, nicht nur bei dir, diese furchtbare Tendenz, jede Empfehlung gleich als vernichtende Kritik zu lesen und darauf mit Selbstverblödung und Eitelkeit zu reagieren
tut mir Leid, aber ich sehe wirklich keine Qualitäten in deinem Text, deshalb gab es auch sowieso kein Lob, und nein, ich komme nicht aus der Unterhaltungsliteraturecke und nein, wenn man einen schlechten Text geschrieben hat, ist man noch lange nicht intellektuell, und nein, das Schreiben wollte ich dir nicht madig machen, aber Arbeit an einem Text ist eben Arbeit an einem Text und wenn du das nicht tun willst, soll es mir auch recht sein
R. führt dann noch ominöse Preise an, die er gewonnen hat und Veröffentlichungen, mit denen er - angeblich - herumwedeln kann. Vor allem bezieht er sich auf einen Radiomoderator (Name unbekannt), der selbst Bücher veröffentlicht hat und seine Texte gelobt habe:
Der spezielle Radiomoderator ist selbst Autor, hat schon einige Bücher veröffentlicht. Und ich hatte nie vor, Unterhaltungsliteratur zu schreiben, geschweige denn billige Ratgeber zu kaufen und zu lesen.
Und was ich dir vor allem vorwerfe (Geschmäcker sind schließlich verschieden), ist die Form der Kritik, die äußere Gestalt. Das Forum, in dem derartige Kritik als hervorragend angesehen wird, würde ich ehrlich gesagt gerne sehen.
Nun, wir alle wissen um die Qualität unserer deutschen Veröffentlichungen. Nicht immer kann man damit glänzen. Veröffentlicht zu sein heißt nun mal häufig, dass man einen Markt bedienen kann. Ich erinnere an Fitzeks "Die Therapie", ein wirklich grauenhaftes Buch (bei all den guten Thrillern, die es gibt). Verkauft hat sich das aber hervorragend. Ist der Autor deshalb der deutschen Sprache mächtig? Jein; erzählen kann er jedenfalls eher schlecht bis mittelmäßig.
Fitzek ist übrigens auch Radiomoderator. Dieser Status ist also kein Kriterium für inhaltliche und sprachliche Qualität.
Sehr spannend ist auch, dass R. hier die Form der Kritik (meinerseits) bemängelt. Das ist insofern spannend, als er damit der inhaltlichen Kritik von Anfang an ausgewichen ist. Dies ist immer noch ein sehr beliebter Trick von Menschen, die an Selbstimmunisierung leiden. Dummerweise scheint dies in der heutigen Zeit durchaus ein Karrierekriterium zu sein und so kann ich R. eine glänzende Laufbahn voraussagen.
Dass er sich nicht mit Ratgebern auseinandersetzen mag, ist genauso hübsch. Vor allem billigen Ratgebern. Herr Gesing wäre sehr erfreut, wenn er dies hören würde. Und erst Herr Schneider. Von diesen beiden Autoren habe ich R. nämlich Bücher empfohlen, einmal "Kreatives Schreiben" (Gesing) und einmal von Wolf Schneider insgesamt die Ratgeber zu gutem Deutsch. Leider ist Herr Gesing nur freier Autor und nur promoviert und deshalb unter der Würde von R. Und auch Wolf Schneider als Autor und Stern-Redakteur ist viel zu niedrig angesiedelt, um diesen jungen Mann noch sachgerechte Erfahrungen zu bieten.
Ich hätte da auch noch zwei amerikanische Schreibratgeber von Pulitzer-Preisträgern anzubieten, die R. zu billig sein dürften.
Kritik
Was also ist Kritik?
Kommentar, Kritik, Schrift wären in der Tat eine Antwort an den, der nicht möchte, dass ich antworte; bleibt es ohne Antwort, bläst sich das Werk zu einer riesigen, kompakten Behauptung auf, das ist meine (pessimistische oder realistische) Sicht ersten Grades; doch indem ich es kommentiere (das heißt: aktiv lese), antworte ich ihm, banne ich das Zwangsverhältnis, dem es mich unterwirft (dem mich im Grunde jedes Werk, jedes Sprechen unterwirft).
So schreibt Roland Barthes in seinem Buch "Das Neutrum".
Vielleicht ist es hier nicht so wichtig, dass die Kritik verhindert, dass sich ein Werk aufbläst. Ich denke nur an Prousts Art zu schreiben, der die angemahnten Korrekturen weitestgehend missachtete und stattdessen noch mehr Text in die Korrekturfahnen schrieb.
Wichtiger ist, dass Kritik eine aktive (allerdings tatsächlich keine "gerechte") Form des Lesens ist.
Man beachte, dass der Begriff - ausgehend von der Philosophie selbst oder innerhalb ihrer - dialektisch in Frage gestellt werden kann (lassen wir Nietzsche beiseite, der nicht innerhalb der Philosophie stand): eine marxistisch inspirierte Philosophie: Henri Lefebvre, De L'Etat, IV, S. 15: »Nur auf den Begriff gebracht hat das Denken Konsistenz, ist es verständlich und mitteilbar.
Um sein Ungenügen zu erweisen, um an den Tag zu bringen, was diesseits und Jenseits von ihm ist, gilt es ihn zu überschreiten«! Tyrannei des Begriffs? Ja, analog der Tyrannei des Staates. Nein, denn die Verwendung des Begriffs schließt Selbstkritik ein, die nicht Sache der Tyrannen ist.
Freilich war es Nietzsche, der den Begriff am gründlichsten demontiert hat (in beiden Bedeutungen des Wortes (Barthes erläutert mündlich den Doppelsinn von demonter, »zerlegen« und »stürzen« : »wie man einen Mechanismus zerlegt; und wie das Pferd einen Reiter abwirft«.)):
»Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nichtgleichen.« : Begriff also: Kraft zur Reduktion des Mannigfaltigen, des sinnlichen Werdens, der aisthesis : wollte man diese Reduktion ablehnen, müsste man nein zum Begriff sagen, dürfte sich seiner nicht bedienen. Doch wie sollten wir, wir Intellektuellen, dann sprechen? In Metaphern.
Den Begriff durch die Metapher ersetzen: schreiben.
Diese sehr zentrale Stelle steht für den guten Umgang mit dem Begriff: der Begriff ist ein kognitives Ereignis, keines, was auf dem Papier stattfindet: insofern gibt es keine wissenschaftliche Literatur, sondern nur eine verschleierte Lyrik der Physik, der Chemie, der Medizin, etc. Selbst das Sprechen, dieses so persönliche Umgehen mit dem Wissen, erzeugt Metaphern. Der Begriff ist nur im Hintergrund a-präsentiert, d.h. "nicht so ganz vorhanden".
Als Zwischenanmerkung sei hier eingeschoben, dass es zwar in der Schule wichtig ist, Begriffsbildung zu betreiben, dass es aber keinesfalls wichtig ist, diese Begriffe zu können, vor allem nicht, wie der Lehrer sie meint. Der Begriff als kognitives Ereignis verlangt einen ganz anderen Umgang: er muss einerseits angeregt, aber nicht nachgeprüft werden, denn der Lehrer kann tatsächlich nicht den Begriff prüfen, sondern nur die Metaphern; zweitens aber muss aus den Metaphern eine produktive Rekonstruktion des Begriffs durch den Lehrer geleistet werden (im Sinne einer Diagnostik).
Es ist zum Beispiel kompletter Schwachsinn, wenn immer noch behauptet wird, lernbehinderte und geistigbehinderte Menschen hätten keine Begriffe.
Ihr Problem ist vielmehr, dass sich ihre Begriffe nicht so gut "verwechseln" lassen: Wenn ich mich mit einem Menschen über einen Begriff unterhalte, stellt sich oft die Situation ein, dass ich meinen Begriff mit dem Begriff des Anderen verwechsle. In Wirklichkeit aber sind es zwei Metaphern, die in einem wechselseitigen Ersetzungsverhältnis stehen: also zwei Metaphern, die einen metaphorischen Bezug haben.
Hat ein Mensch eine ungewöhnliche Weltsicht, oder wird diese ungewöhnliche Weltsicht bei einem Menschen angenommen oder unterstellt, dann denunziere ich im Prinzip seine Begriffsbildung als "ungleich" und oft genug als "minderwertig" oder als "garnicht vorhanden". Genau dies passiert nun bei "fremdartigen" Menschen. Statt hier ins Spiel der Metaphern einzusteigen, wird eine hierarchische Begriffsqualität angenommen - natürlich meist zu den eigenen Gunsten.
Was nun die Kritik angeht, so bleibt diese so lange abstrakt, so lange sie nicht prozesshaft gedacht werden kann und nicht prozesshaft geführt wird. Die Kritik ist nicht so sehr eine Struktur, die von außen beschreibt - als solche wird sie aber oft gehandhabt -, sondern ein Stolperstein, der sich im Inneren eines Prozesses einnistet.
Textkritik, die sich auf diesen Prozess einlässt, ist notwendig hart und freundlich zugleich: Ich verweise hier auf die Art und Weise, wie Alex mit der Kritik an seinen Texten umgeht und ebenso auf die Kommentatoren, wie diese sich mit seinem Text auseinandersetzen. All dies ist vorbildlich (als Prozess; inhaltlich kann man das und darf man das anders sehen).
Die Zerlegung des Begriffes Kritik kann nur selbst über die Kritik laufen. Die Kritik müsse sich praktisch selbst demontieren. Dies aber kann in der Kürze nur einen unfruchtbarer Zirkelschluss produzieren. Die eine Möglichkeit, diesem Zirkelschluss zu entkommen, ist die Hierarchisierung. Notwendigerweise aber muss diese Hierarchie selbst unkritisiert bleiben, weil sie sonst den Ausweg selbst zerstören würde und wieder beim alten Problem ankommen würde: dem Zirkelschluss. Die andere Möglichkeit (die auch von den Systemtheoretikern bevorzugt wird) ist die Temporalisierung. Die Temporalisierung ist hier übrigens keine Politik der kleinen Schritte, also ein Verfahren, sondern eine Grundhaltung, die sich selbst immer wieder in den Prozess der Kritik mit hinein holt, selbst wenn sie nicht der ursprüngliche Gegenstand der Kritik ist. Kritik muss in sich selbst notwendigerweise fremdartig sein (also paradox), da sie sonst notwendigerweise gleichförmig bleibt (also tautologisch). Eine in sich notwendig fremdartige Kritik bleibt heterogen, auch unsystematisierbar. Sie ist vielleicht nicht "wissenschaftlich", aber sie entspricht dem demokratischen Sein, das in sich ebenfalls heterogen ist und trotzdem eine Einheit behauptet.
Die Aufgabe der Kritik liegt nicht einfach darin, »gegen« das Gesetz zu sprechen, als wäre das Gesetz dem Sprechen äußerlich und Sprechen der privilegierte Ort der Freiheit. Wenn Sprechen auf Zensur beruht, dann ist das Prinzip, dem man sich womöglich widersetzen will, zugleich das Formprinzip der Widerrede. Es gibt keine Opposition gegen die Grenzlinien der Verwerfung außer der, die genau diese Grenzlinien neu zieht. Doch zeigt sich hier keine Sackgasse für die Handlungsmacht, sondern die zeitliche Dynamik und das Versprechen, das in ihrer spezifischen Gebundenheit liegt. Es bleibt möglich, die Voraussetzungen des Sprechens auszunutzen, um eine zukünftige Sprache zu schaffen, die in diesen Voraussetzungen noch nirgends impliziert ist.
Judith Butler geht hier von einer anderen Seite an das Problem der Kritik heran. Dem Sprechen selbst ist die Zensur immanent: da das Sprechen auf (akustischen) Einheiten beruht, deren (kognitiver) Gehalt nicht einheitlich ist, oft auch diffus oder sogar leer, zensiert das Sprechen die "Gedanken". Diese Zensur ist strukturell bedingt. Auch der Einspruch gegen eine institutionelle Zensur kann die strukturelle Zensur nicht abschaffen. Die Form der Widerrede, die gegen die Zensur angeht, kann hier nicht zu einer Abschaffung der Zensur führen, weder der strukturellen, noch der institutionellen, sondern nur ihr Interessenbündnis zerreißen.
Es gilt also, der Institution den willkürlichen Gebrauch über das Sprechen zu entreißen.
Die Kritik als Institution ist also nur solange akzeptiert, solange sie sich auf ein strukturell zensiertes Sprechen stützt, ohne dies thematisieren zu wollen. Koppelt man beides voneinander ab, wird die Kritik als Institution uninteressant. Dagegen wird die strukturelle Zensur kritisch, und zwar im doppelten Sinn des Wortes: 1.) die strukturelle Zensur selbst ist Ort und Ziel der Kritik, 2.) die strukturelle Zensur "verhält sich" kritisch, schwankend, ungewiss.
Diese Art des Umgehens der Zensur muss spielerisch und umweghaft bleiben, mithin nicht nur prozessual und temporalisiert, sondern im Wesentlichen auch ein wenig "verrückt", nicht dort, wo sie sein sollte. Sie kann nur dort sein, wo sie nicht ist.
Lacan hat diese Zensur als Ort der Wahrheit, die zugleich Unwahrheit ist, als Ort, an dem nicht sauber getrennt werden kann zwischen wahr und falsch, einmal so beschrieben:
"Ich sage immer die Wahrheit, nur nie die ganze Wahrheit, denn die ganze Wahrheit zu sagen ist unmöglich."
In diesem Sinne also wünsche ich R. viel Glück.
Kritische Homosexualität / Paranoia! Paranoia!
Die Anregung zur Bildung des Ichideals, als dessen Wächter das Gewissen bestellt ist, war nämlich von dem durch die Stimme vermittelten kritischen Einfluss der Eltern ausgegangen, an welche sich im Laufe der Zeiten die Erzieher, Lehrer und als unübersehbarer, unbestimmbarer Schwarm alle anderen Personen des Milieus angeschlossen hatten. (Die Mitmenschen, die öffentliche Meinung.)
Große Beträge von wesentlich homosexueller Libido wurden so zur Bildung des narzisstischen Ichideals herangezogen und finden in der Erhaltung desselben Ableitung und Befriedigung. Die Institution des Gewissens war im Grunde eine Verkörperung zunächst der elterlichen Kritik, in weiterer Folge der Kritik der Gesellschaft, ein Vorgang, wie er sich bei der Entstehung einer Verdrängungsneigung aus einem zuerst äußerlichen Verbot oder Hindernis wiederholt. Die Stimmen sowie die unbestimmt gelassene Menge werden nun von der Krankheit zum Vorschein gebracht, damit die Entwicklungsgeschichte des Gewissens regressiv reproduziert. Das Sträuben gegen diese zensorische Instanz rührt aber daher, dass die Person, dem Grundcharakter der Krankheit entsprechend, sich von all diesen Einflüssen, vom elterlichen angefangen, ablösen will, die homosexuelle Libido von ihnen zurückzieht. Ihr Gewissen tritt ihr dann in regressiver Darstellung als Einwirkung von außen feindselig entgegen.
Die Klage der Paranoia zeigt auch, dass die Selbstkritik des Gewissens im Grunde mit der Selbstbeobachtung, auf die sie gebaut ist, zusammenfällt. Dieselbe psychische Tätigkeit, welche die Funktion des Gewissens übernommen hat, hat sich also auch in den Dienst der Innenforschung gestellt, welche der Philosophie das Material für ihre Gedankenoperationen liefert. Das mag für den Antrieb zur spekulativen Sytembildung, welcher die Paranoia auszeichnet, nicht gleichgültig sein.(Sigmund Freud, Zur Einführung des Narzissmus)
10.11.2006
Tod! Und zwar der echte!
Ich: Das ist doch schön. Der Tod steht für Transformation und Wiedergeburt.
Er: Nein, bei dir ist das der echte Tod.
Ich: Schade, aber eigentlich wusste ich das schon.
08.11.2006
Kreativität (ein erstes Download)
Neuerdings gibt es auf meiner Website ein erstes Download, einen kleinen Text mit dem Titel "Was ist Kreativität?". Ich habe diesen Text möglichst frei von wissenschaftlichen und philosophischen Vokabeln geschrieben, da ich ihn als Anregung verstehe. Zwei Philosophen kommen darin trotzdem vor, Gilles Deleuze und Bernhard Waldenfels. Beide mag ich sehr gerne. Beide habe ich leider nur grob abgehandelt. Aber alles genauere hätte den Rahmen gesprengt.
Wer an Deleuze oder Waldenfels interessiert ist, der muss sich - zunächst noch - selbst bei den beiden informieren.
Ein Traum von mir wäre es, noch einmal eine lange und gute Einleitung in die Philosophie von Deleuze zu schreiben, die seine Logik grundlegend aufarbeitet. Die bisherigen Einführungen zu Deleuze sind mir zu "oberflächlich" geschrieben, zu wenig präzise, mit viel zu vielen großen Begriffen und zu wenig Erklärungen der faszinierenden Logik dieses Denkers.
05.11.2006
Wer sich mit Psychoanalyse auskennt, ...
Ich habe meinem Sohn (aus Artemis Fowl - Der Geheimcode) folgendes vorgelesen:
"Holly schaltete ihre Flügel auf Sintflut und schwebte langsam hinunter auf den Landeplatz."
Ich: "Ja, äh, Sinkflug ..."
Mein Sohn: Kicher!
01.11.2006
Neulich in einer Online-Besprechung
A schrieb:
der weg mein sterngeheimnis verzerrt reflektiert vom spiegel deiner seele verkümmernd unter deiner erwartungshaltung ich reite auf verschiedenen pferden in andere träume und du nach bad nauheim
B schrieb:
was ich nicht so gut finde, ist, dass sich Erwartungshaltung nicht auf Bad Nauheim reimt
C schrieb:
Dazu fällt mir dann nichts mehr ein.
Zahlt Satan auch?
Vor mir packte ein junger Mann sein Stück Käse und eine Packung Aldi-Schwarzbrot auf's Fließband. Als er sich umdrehte, sah ich, dass er sich umgedrehte Kreuze und seltsame Symbole ins Gesicht gemalt hatte, wohl mit einem schwarzen Filzstift.
Leider konnte ich nicht verhindern, dass ich ihn ein wenig länger angestarrt habe als es höflich gewesen wäre.
"Was schausten so?", fragte er darauf hin.
"Sie haben da was im Gesicht."
"Das ist, weil ich Satan gehöre."
"Zahlt der wenigstens Werbegebühren?"
"Was?"
"Naja, wenn Sie schon öffentlich für ihn Werbung machen, würde ich mir das wenigstens bezahlen lassen."
Daraufhin sagte der junge Mann nichts mehr.
Nachtrag
Andererseits muss man auch sagen, dass dieser etwas paranoide Mensch vielleicht ernsthaft glaubt, die Menschen würden ihn "besonders" anblicken. Und wenn er sich dann solche Zeichen ins Gesicht schmiert, macht er diese Blicke real und gibt ihnen einen Grund. Es ist also nicht paranoid, wenn er das tut, sondern eigentlich das Gegenteil davon.
28.10.2006
Zitate, tolle, die
"Ich halte darauf, dass man Theorien nicht machen soll - sie müssen einem als ungebetene Gäste ins Haus fallen, während man mit Detailarbeiten beschäftigt ist."
Von Tobias Geissmann habe ich folgendes Zitat von Wittgenstein:
"Sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen ist wie auf einer Schneewanderung auszuruhen. Du nickst ein und stirbst im Schlaf."
Zum Schluss, deshalb fiel mir dieser Beitrag ein, ein Zitat von Kronprinz Frederik von Dänemark, das ich heute in der Zeitung gefunden habe:
"Wenn man eine neue Tätigkeit schon im Voraus genau beschreiben kann, dann ist man überqualifiziert dafür."
26.10.2006
Eine Geschichte anfangen (Kritik und Tipps)
Da ich immer wieder erstaunt bin, dass sich viele Anfänge so trocken und wirr lesen, habe ich hier mal ein paar Tipps zusammen gestellt und eine Kritik zu Zaddits Anfang geschrieben.
Kritik und Tipps
Ich gebe auch mal kurz meinen Senf zu deinem sehr kurzen Text ab:
Grundsätzlich finde ich ihn zu dicht gedrängt. Du bringst sehr rasch die Erklärung für die Suche deines Protagonisten.
Statt dessen würde ich mir überlegen, wie genau du dies noch ein Stück weit hinauszögern kannst und statt dessen die Spannung erhöhst.
Zwei Sachen kannst du dazu benutzen, dass du die Lösung deines Rätsels nach hinten schiebst: einmal würde ich stärker den Protagonisten charakterisieren. Wer ist das überhaupt? Allerdings nicht so, indem du es berichtest, sondern indem du erzählst: also viele kleine Handlungen so aneinanderketten, dass der Charakter typisch wird.
Zum anderen, indem du die Umgebung genauer beschreibst. Schlösser sind ja nicht gleich Schlösser, sondern sehr verschieden sind.
Hier greift ganz gut der Trick, bestimmte Gegenstände im Schloss mit Erinnerungen zu verbinden: solltest du z.B. den vierten Band von Harry Potter zu Hause haben, dann ließ dir doch mal das zweite Kapitel durch. Da findest du sozusagen ein Kondensat an Tricks, um einen Charakter in seiner Umgebung zu rekapitulieren.
Wenn du etwas erklären willst, dann nutze dafür die Momente, in denen sich die Spannung abschwächt: d.h. zuerst erhöht sich die Spannung: wo ist die Schwester, erreiche ich sie rechtzeitig? dann finde ich eventuell die Schwester und dann kann ich, möglichst in einem Dialog, dieses kleine Quäntchen Wissen einbringen.
Der Verlauf sähe dann (als Vorschlag) so aus:
1. auf der Suche nach der Schwester
1.1. im Schloss herum laufen
1.2. besorgt sein (aber den Leser hängen lassen, warum der Prot. besorgt ist)
1.3. an besonderen Orten suchen (und diese beschreiben)
1.4. zwischendurch die Nervosität ansteigen lassen, nach der BAP-Formel: Besorgnis, Aufregung, Panik (danke! für diese Formel musst du mir kein Geld bezahlen)
1.5. auf die unwahrscheinliche Idee kommen
1.6. dort suchen
1.7. die Schwester finden
2. Medizin geben
2.1. Schwester beruhigen
2.2. zeigen, dass sie ihre Magie (noch) nicht beherrscht
2.3. Medizin einflößen
2.4. Erfolg löst gleichzeitig den nächsten Konflikt aus: Ärger über die Schwester (dieser wird in Gedanken oder szenisch, also als Handlung, dem Leser nahe gebracht)
3. Gespräch mit der Schwester
3.1. Hier kommt jetzt, im Dialog, die Erklärung oder:
3.2. die erschöpfte Schwester ins Bett bringen, warten, bis sie eingeschlafen ist, dann die Erinnerung, wie die Schwester ihre Magie zum ersten Mal entdeckt
Denn im Prinzip mischst du in deinem Text zwei Szenen: einmal die aktuelle Handlung (die, da sie alleine abläuft, monologisch ist: sie ist keine wirkliche Konflikthandlung, sondern eine Handlung zur Vermeidung von Konflikten - das ist zwar auch ein Konflikt, muss aber in Erzählungen anders gehandhabt werden); zum anderen die Erinnerung an das Entdecken der Magie.
Diese beiden Szenen ineinander zu wurschteln ist hohe Kunst. Stephen King kann das. Joan Rowling bedient sich hier allerlei (guter) Tricks, um dem zu entkommen. Patricia Cornwell ebenso. Ich denke, deine Szene würde nicht holpern und stocken, wenn du die beiden Teile gut trennst.
Grundsätzlich für das erste Kapitel solltest du dir auch noch überlegen, dass du schon Hinweise legst, warum die Schwester mit dem ganzen System in Konflikt kommt - denn nicht mehr und nicht weniger solltest du anpeilen. D.h. im ersten Kapitel sollte der Schritt von der Einleitung (etwa das erste Fünftel eines Buches) in die Durchführung (drei Fünftel eines Buches) zumindest nebensächlich angedeutet sein. Im vierten Band von Harry Potter wird gleich im ersten Kapitel der finstere Plan enthüllt. Nur dadurch entkommt Rowling einer umfangreicheren Einleitung. Im dritten Buch dagegen wird die Tür zur Durchführung in dem Moment durchschritten, in dem Harry erfährt, dass Sirius Black hinter ihm her ist (bzw. her sein soll). Im ersten Buch von Artemis Fowl ist zu Beginn des ersten Buches die Tür zum Konflikt längst durchschritten: nämlich schlicht und einfach durch den Willen von Artemis, die Welt notfalls in Schutt und Asche zu stürzen, Hauptsache, er kommt an sein Geld. Klassischere Einleitungen findest du z.B. in den Thrillern von Clive Cussler. Die Einleitung dient meist dem Kontakt mit dem Feind, knüpft aber noch kein verpflichtendes Band zwischen dem Feind und dem Helden. Innerhalb der ersten fünfzig Seiten kommt dann aber eine persönliche Notwendigkeit dazu. In "Der Todesflieger" ahnt Agent Dirk Pitt, dass die Sabotageakte, die er untersuchen soll, etwas mit dem Angriff zu tun haben, in den er vorher zufällig verwickelt war. Darauf hin bringt er beide Ereignisse zusammen und trifft natürlich ins Schwarze. In "Im Todesnebel" bekommt Agent Pitt den Auftrag, mit der Navy zusammen nach einem verschollenen Atom-U-Boot zu suchen, nachdem er 1. eine geheimnisvolle Nachricht von diesem U-Boot gefunden hat (1. Kontakt) und 2. von einer geheimnisvollen Frau beinahe überwältigt wurde (2. Kontakt). Der Auftrag läutet die Durchführung ein, und gleich danach findet der 3. Feind-Kontakt statt, usw. zieht sich das Buch actionreich und ganz nett konstruiert bis zum Ende hin.
24.09.2006
Adorno: Demontagen (Begriffsbildung II)
Zusammenfassung
Zweifel am Begriff
Identität. – Adorno denunziert den Begriff als scheinhaft. Dieses Scheinhafte ist durch seine angebliche Identität mit der Sache selbst gegeben. Dabei ist aber diese Identität keine Verfehlung, sondern dem Denken immanent: "Denken heißt identifizieren." (ND, S. 17). Die begriffliche Ordnung überformt und verdrängt die begreifbare Welt und stellt damit das Denken still (ND, S. 16f).
Zwangscharakter. – Begriffe sollen nach der Norm der adaequatio den Satz des ausgeschlossenen Dritten verwirklichen (ND, S. 17). Dieses Prinzip schiebt alles Nicht-Identische beiseite und wendet sich damit auch gegen das "objektive" Denken selbst: "Was an dem zu Begreifenden vor der Identität des Begriffs zurückweicht, nötigt diesen zur outrierenden Veranstaltung, dass nur ja an der unangreifbaren Lückenlosigkeit, Geschlossenheit und Akribie des Denkprodukts kein Zweifel sich rege." (ND, S. 33)
Widerspruch. – Was der Begriff ausschließt, taucht trotzdem wieder auf, diesmal aber als Widerspruch (ND, S. 17): "Er ist Index der Unwahrheit von Identität, des Aufgehens des Begriffenen im Begriff." (ND, S. 16)
Versöhnung. – Um dieser Unwahrheit zu entkommen und nicht selber dem Zwangscharakter der Identität zu verfallen, soll die Versöhnung angestrebt werden: "Diese gäbe das Nichtidentische frei, entledigte es noch des vergeistigten Zwanges, eröffnete erst die Vielheit des Verschiedenen, über die Dialektik keine Macht mehr hätte. Versöhnung wäre das Eingedenken des nicht länger feindseligen Vielen, wie es subjektiver Vernunft anathema ist." (ND, S. 18)
Dialektik. – An dieser Stelle greift dann eine Paradoxie, die Adorno in der Negativen Dialektik entfaltet. Die Dialektik folgt auf der einen Seite dem Zwangscharakter der Logik, aber auf der anderen Seite demontiert sie gerade diesen Zwangscharakter noch, indem sie 1.) der Entfaltung der Differenz von Allgemeinem und Besonderen folgt, und 2.) diese Entfaltung selbst noch als Allgemeines sieht und dies mit dem Besonderen vermittelt. Die Dialektik wendet sich so gegen sich selbst und zerstört sich, indem sie sich rigoros ausübt. (ND, S. 18) "Die Arbeit philosophischer Selbstreflexion besteht darin, jene Paradoxie auseinanderzulegen." (ND, S. 21)
Nicht Begriffsbildung, sondern Begriffsdemontage
Blick auf die Sachen. – Wie nun sieht ein solches Umdrehen aus? Adorno gibt darauf keine einfache Antwort, aber Leitlinien. Zunächst gilt der Blick den Sachen selbst und der Gedanke habe vor diese keine befriedenden Begriffe zu schieben, sondern sich zu entäußern, mit spekulativer Kraft noch das Unauflösliche der Identität des Gegenstands mit seinem Begriff zu sprengen (ND, S. 38).
Pole. – Die beiden Pole, zwischen den Adorno hin- und herchangieren will, sind Einsicht in Wirkliches und das Spiel (ND, S. 26). Damit will sie zum einen verbindlich bleiben, zum anderen aber dem Zwangscharakter entgehen. "An [der Philosophie] ist die Anstrengung, über den Begriff durch den Begriff hinauszugelangen" (ND, S. 27). Dabei zieht Adorno Parallelen zu dem Pragmatismus und der Skepsis Deweys: man muss sich in die Erkenntnis engagieren, aber um ihr Fehlgehen wissen (ND, S. 25).
Alogisches. – Dabei kommt Adorno immer wieder auf die Demontage der Logik zurück: das Spiel bliebt notwendiger Bestandteil, auch wenn es clownesk, willkürlich, alotria ist. Dieses Spiel aber als Moment der Wirklichkeit zu begreifen, ist durch die Dialektik einzuholen und aufzugeben. Dies kommt – vielleicht neben den Gedanken zu Auschwitz (ND, S. 354ff) eine der berührendsten Stellen im Buch – im Selbstübersteigen des Gedankens zum Ausdruck: "Worin der Gedanke hinaus ist über das, woran er widerstehend sich bindet, ist seine Freiheit. Sie folgt dem Ausdrucksdrang des Subjekts. Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet; was es als sein Subjektivstes erfährt, sein Ausdruck, ist objektiv vermittelt." (ND, S. 29) und etwas weiter sagt Adorno dazu, zirkulär argumentierend: "Ausdruck und Stringenz sind ihr keine dichotomischen Möglichkeiten. Sie bedürfen einander, keines ist ohne das andere. Der Ausdruck wird durchs Denken, an dem er sich abmüht wie Denken an ihm, seiner Zufälligkeit enthoben." (ND, S. 29)
Modelle. – Der Begriff, der in das Argument ebenso eingebunden ist wie in den Ausdrucksdrang, wird von beiden überstiegen. Negative Dialektik versucht die Argumente ebenso zu entfalten, wie den Ausdrucksdrang dialektisch einzuholen. Dass sie dabei selbst argumentiert, dass sie dabei selbst einem Ausdrucksdrang folgt, macht ihr die totale Erkenntnis zu einer Utopie. Fragmentierte Erkenntnis ist schließlich das, was der Philosophie noch taugt: "Die Forderung nach Verbindlichkeit ohne System ist die nach Denkmodellen. ... Das Modell trifft das Spezifische und mehr als das Spezifische, ohne es in seinen allgemeineren Oberbegriff zu verflüchtigen. Philosophisch denken ist soviel wie in Modellen denken; negative Dialektik ein Ensemble von Modellanalysen. Philosophie erniedrigte sich erneut zur tröstlichen Affirmation, wenn sie sich und andere darüber betröge, dass sie, womit immer sie ihre Gegenstände in sich selbst bewegt, ihnen auch von außen einflößen muss." (ND, S. 39)
Konstellation. – Eines dieser Modelle wird durch den Begriff der Konstellation bezeichnet. In der Konstellation wird nicht durch Abstraktion ein neuer Oberbegriff gebildet, sondern die Begriffe treten in Beziehung zueinander, "zentriert um die Sache selbst" (ND, S. 164). "Konstellationen allein repräsentieren, von außen, was der Begriff im Innern weggeschnitten hat, das Mehr, das er sein will so sehr, wie er es nicht sein kann. Indem die Begriffe um die zu erkennende Sache sich versammeln, bestimmen sie potentiell deren Inneres, erreichen denkend, was Denken notwendig aus sich ausmerzte." (ND, S. 164f)
Essay. – Ein anderes Modell ist der Essay (Adorno: Der Essay als Form): In seiner Entfaltung tauchen alle Elemente der negativen Dialektik wieder auf.
- Nicht-Identität von Begriffen und Sachen: "Weil die lückenlose Ordnung der Begriffe nicht eins ist mit dem Seienden, zielt [der Essay] nicht auf geschlossenen, deduktiven oder induktiven Aufbau." (ebd., S. 17)
- Gegen den logischen Zwangscharakter: "Damit suspendiert [der Essay] zugleich den traditionellen Begriff von Methode. Der Gedanke hat seine Tiefe danach, wie tief er in die Sache dringt, nicht danach, wie tief er sie auf ein anderes zurückführt. Das wendet der Essay polemisch, indem er behandelt, was nach den Spielregeln für abgeleitet gilt, ohne dessen endgültige Ableitung selber zu verfolgen." (S. 18f)
- Ohne Fundament: "Er fängt nicht mit Adam und Eva an sondern mit dem, worüber er reden will; er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe ..." (S. 10)
- Spiel: "Anstatt wissenschaftlich etwas zu leisten oder künstlerisch etwas zu schaffen, spiegelt noch seine Anstrengung die Muße des Kindlichen wider, der ohne Skrupel sich entflammt an dem, was andere schon getan haben. Er reflektiert das Geliebte und Gehasste, anstatt den Geist nach dem Modell unbegrenzter Arbeitsmoral als Schöpfung aus dem Nichts vorzustellen. Glück und Spiel sind ihm wesentlich." (S. 10)
- Wechselwirkung: "Der Essay dafür nimmt den antisystematischen Impuls ins eigene Verfahren auf und führt Begriffe umstandslos, »unmittelbar« so ein, wie er sie empfängt. Präzisiert werden sie erst durch ihr Verhältnis zueinander. Dabei jedoch hat er eine Stütze an den Begriffen selber. Denn es ist bloßer Aberglaube der aufbereitenden Wissenschaft, die Begriffe wären an sich unbestimmt, würden bestimmt erst durch ihre Definition." (S. 20)
- Dabei ist das Wie des Ausdrucks (S. 20) – als reflektiert auf den Ausdrucksdrang – ebenso wichtig, wie die teppichhafte Verflechtung der Argumente (S. 21) – als Widerstand gegen die logische Ableitung, die eine Einbahnstraße behauptet. Dieses Ablehnen von Induktion und Deduktion legen das Dritte, die Abduktion, nahe (vgl. auch S. 22).
- Deshalb wird auch das Vergängliche nicht zu einem Ewigen abstrahiert, sondern im Essay – als Intention - wird das Vergängliche als Vergängliches zu verewigen versucht. (S. 18)
- Indem der Essay auch die Begriffe und Theorien, die sich um einen Gegenstand konstellieren, indem er diese nicht als Erklärung für den Gegenstand nimmt, sondern nur als Hinzielen auf diesen, übt er auch immanente Kritik an geistigen Gebilden: er konfrontiert die Begriffe mit ihrem Zusammenhang und ist insofern Ideologiekritik. (S. 27)
Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1994
ders.: Der Essay als Form. in: ders.: Noten zur Literatur, Frankfurt am Main 1994, S. 9-33.
Hans Aebli (Begriffsbildung I)
Einleitung
AEBLIs Theorie der Begriffsbildung
Psychische Funktionen des Begriffs
- Distanzierung von der Situation,
- Isolierung der in ihr enthaltenen Elemente und Beziehungen,
- reine, durchsichtige Fassung der Struktur ("Ordnung"),
- Abgrenzung derselben aus dem Kontext, bei gleichzeitiger Klärung der Beziehungen zu diesem.
Sie haben, im Gegensatz zum Handeln, keinen unmittelbaren Nutzen, und sollen stattdessen "dem erkennenden Geist ein Stück Wirklichkeit fassbar machen". "Das Anliegen ist dasjenige der Transparenz und der Konsistenz der Darstellung." (Aebli, 1994, 84)
Begriffe sind „Reinigungen“, Abstraktionen von der konkreten Realität. Sie bilden eine Struktur ab, deren wesentliches Merkmal es ist, unzeitlich, zeitlos oder überzeitlich zu sein. Selbst aus Vorgängen werden, bilden sie sich in Begriffen ab, „quasi-dingliche Gegebenheiten“. (Aebli 1994, 84f.)
Begriffsbildung
- Auswählen der relevanten Elemente
- Abstrahieren der Elemente von anderen Wirklichkeitsbezügen
- Koordinieren der Elemente
Rollenzuweisung
Kritik
- Obwohl Aebli Begriffe als Objektivierungen schildert, bleiben seine dargestellten Begriffe offizielle Versionen von Gegenständen, Handlungen und Vorgängen. Genau dies aber führt dazu, dass Aebli diese als Bestandteile eines Lexikons identifiziert, das eine gewisse Wissenschaftlichkeit mit sich bringt. Zunehmend verliert Aebli dabei den Halt in einer Verwissenschaftlichung, die das eigentlich Spannende nicht mehr nachzuvollziehen und darzustellen weiß: wie sich Begriffe alltäglich bilden.
- Daraus resultiert ein weiteres Problem: wenn sich Begriffe psychisch bilden, kann man ihnen dann eine allgemeine Version unterstellen, oder muss man sie, im Sinne einer Subjektorientierung und Lebensweltorientierung nicht in eine Subjektivität fassen, die sich gerade nicht zeitlos gültig darstellen lässt?
- Wahrscheinlich resultiert aber das ganze Problem der Begriffsbildung aus einem weiteren Aspekt: dem der Beobachtbarkeit. Wenn Begriffe kognitive Phänomene sind (zumindest in der Psychologie), wie lassen sie sich beobachten oder nachkonstruieren?
- Daran schließt sich gleich ein weiteres Problem an: wann entstehen die ersten Begriffe? Sind sie erst dann vorhanden, wenn ein Kind mehr als Einwortsätze äußern kann, also auch für den Beobachter Beziehungen sprachlich ausdrücken kann oder ist ein Kind, das Mehl, Eier und Milch in einer Schüssel zusammen kippt, aber nur die Elemente einzeln und Kuchen als Ergebnis benennen kann, schon in der Lage, einen Begriff von "Kuchen backen" zu haben?
- Schließlich greift Aebli sehr häufig, ohne es durchzuziehen, auf die Sprachlichkeit, bzw. symbolische Fassbarkeit von Begriffen zurück. Sind Begriffe aber tatsächlich symbolisch fassbar? In diesem Falle ließen sie sich tatsächlich in einem Lexikon objektivieren. Oder haben Begriffe und damit auch Begriffsbildungen einen starken, aber oft nicht erkannten außersprachlichen Kern?
- Dass Begriffsbildungen sich alltäglich vollziehen und eng mit sozialen Rollen, emotionalen Färbungen und Orientierung in der Lebenswelt zusammenhängen, kann man an dem oben gegebenen Beispiel mit dem Blumenstrauß sehen. Neben der Ausprägung dessen, was als Begriff gelten soll, beachtet Aebli zu wenig, dass Begriffe wahrscheinlich als ganzheitliche Ordnungsleistungen gedacht werden müssen. Die Rolle der Emotionalität wird nicht erfasst, ebenso wenig aber die Funktionalität unscharfer Begriffe (und wer hätte das nicht erlebt, dass gerade Worthülsen zunächst sehr eindrucksvoll klingen und ebenso eindrucksvoll strukturieren, dann aber, hinterfragt man sie gründlich, in sich zusammen fallen).
- Daran ist die Frage der Flüchtigkeit anzukoppeln: wenn Begriffe konkretisiert werden, bilden sie vielleicht, aber eben nur vielleicht, neue Begriffe. Wann, unter welchen Bedingungen der Stabilität von Wissen, gehen Konkretisierungen oder Abstrahierungen in neue Begriffe über?
- Sind Begriffe lediglich "Identifikationen eines bestimmten Phänomens" (Aebli 1994, 88)? Schon hier verwischt sich Aebli massiv selbst, da er zugleich sagt, Begriffe dienten nur der Identifikation eines Phänomens (sind aber diese Identifikation nicht selbst). Zwischen der Disposition, ein Phänomen wahrnehmen zu können, (Kompetenz) und der Wahrnehmung eines Phänomens (Performanz) sollte allerdings ein Unterschied gemacht werden.
Aebli hat, so scheint es mir, sich hierbei zu sehr von wissenschaftlichen Methoden der Objektivierung und Darstellung leiten lassen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass dies nur ein sehr kleiner Aspekt der Ordnung psychischen (und sozialen) Wissens ist. Gleichwohl liefert er gerade dadurch viele Anregungen, wie Begriffsbildungen in Schule und Studium geleistet, operationalisiert und objektiviert werden können.
Ausblick
- Begriffe sind nicht rein symbolisch. Sie umfassen auch andere wenig flüchtige kognitive Elemente.
- Begriffe sind Ordnungsleistungen im Denken, die emotional und situativ sehr unterschiedlich gefasst und angewendet werden.
- Begriffe sind ordnende Projektionen, die die wahrnehmbare Wirklichkeit auf das Maß vereinfachen, dass Handlungsfähigkeit gegeben ist.
- Schärfe ist kein Gütesiegel des Begriffs, es sei denn in der Wissenschaft. Demnach sind Klärungen, Abstraktionen und Reinigungen auch nicht die wesentlichen Operationen der Begriffsbildung und – denkt man diese weiter - auch nicht die wesentlichen Ziele eines begriffsbildenden Unterrichts.
- Aebli, Hans: Denken: Das Ordnen des Tuns I, Stuttgart 1993
- ders.: Das Ordnen des Tuns II, Stuttgart 1994
20.09.2006
Der Krankenpfleger fragt weiters
Der Hintergrund der Sarkasmus-Nachfrage ist, dass Alice eine Beule am Kopf hat und keine sarkastischen e-mail-Kommentare mehr versteht. Der sarkastische Kommentar war übrigens ausnahmsweise mal nicht auf meinem Mitz (=Mist+Witz) gewachsen, sondern auf dem von Stephan. Stephan kenne ich nun nicht, aber wenn er sarkastisch sein kann, bekommt er auf jeden Fall eine Menge Sympathiepunkte von mir.
Zum Sarkasmus
Panizza war ein Theologe und Otto Julius Bierbaum hat das von seinem Standpunkt aus ganz richtig gefühlt, wenn er nach Veröffentlichung des »Liebeskonzils«, das an zerstörendem Sarkasmus alle antikirchlichen Schriften weit hinter sich lässt, geschrieben hat, der Verfasser sehe nicht weit genug. »Was in ihm hier rebelliert, sagt Bierbaum, ist eigentlich der Lutheraner, nicht der ganz freie Mensch.« (gefunden bei Walter Benjamin, E.T.A. Hoffmann und Oskar Panizza)
Anderthalb Jahre später fällt »A propos de Baudelaire« von der großen Höhe des Ruhms und der niedern des Totenbettes geschrieben, ganz erstaunlich, und freilich auch ganz wundervoll in seinem freimaurerischen Einverständnis im Leiden, seinen déjaillances de la mémoire, mit der Geschwätzigkeit des Ruhenden, dem bis zum Äußersten getriebnen détachement vom Thema, das einer hat, der nur noch einmal sprechen will, gleichviel worüber. Und wie diese Erschöpfung durchwirkt ist mit allem, was der gesunde Proust Bösartigstes, Verschlagenstes hatte. Hier erscheint - dem toten Baudelaire gegenüber - eine Haltung, die Prousts Ökonomie auch im Umgang mit seinen Zeitgenossen bestimmt hat: eine so überschwängliche, divinatorische Zärtlichkeit, das der Rückschlag in den Sarkasmus wie ein unabwendbarer Reflex der Erschöpfung erschien und scheinbar kaum dem Dichter selbst moralisch zugerechnet werden konnte. (Gefunden in den Anhängen zu Benjamins Proust-Aufsatz.)
Ironie ein pädagogisches Mittel des Lehrers (Socrates). Voraussetzung: dass sie eine Zeitlang als Bescheidenheit ernst genommen wird und die Anmaßung des Anderen auf einmal bloß stellt, Sonst ist sie alberne Witzelei. - Sarkasmus ist die Eigenschaft bissiger Hunde am Menschengeiste: vom Menschen dazu gegeben, schadenfrohes Lachen. - Man ruiniert sich, wenn man sich hierin ausbildet. (gefunden in den Nachlässen von Nietzsche zu Menschliches, Allzumenschliches)
Der Sarkasmus besitzt ebenfalls drei Elemente: die bissigen Hunde des Geistes, das schadenfrohe Lachen, die Ruinen des Selbst.
Der bescheidene Lehrer wie die bissigen Hunde sind Rollen, Partial- bzw. Teilrollen, die der Mensch zu spielen vermag. Das Ernst-Nehmen und das schadenfrohe Lachen sind Zwischenschritte von Ironie und Sarkasmus, ihr Wirken in der sozialen Umgebung und das Mitwirken der sozialen Umgebung an Ironie und Sarkasmus, schließlich sind Enthüllung und Ruine die Ergebnisse dieses (Zusammen-)Wirkens.
Nietzsches Idee dahinter ist das Kräftespiel der Interpretationen, das heißt, wie sich das Reden der Dinge bemächtigt. Nietzsche schreibt aus diesem Grund viel über die Einfärbungen der Interpretationen und ihrem unterschiedlichen Grad, die Gegenstände fassbar machen zu können. Mit Einfärbungen meine ich hier solche Metaphern wie "der bescheidene Lehrer", "die bissigen Hunde des Geistes", Ausdruckformen wie "Ernst-nehmen".
Im § 371 (Die Farbe der Umgebung annehmen) von Menschliches, Allzumenschliches weist Nietzsche auf zwei Aspekte des Einfärbens hin: zum einen färbt man sich durch Gewohnheiten ein, zum anderen dadurch, dass der Übergang von der Gleichgültigkeit zur Neigung oder Abneigung nur schwer erkannt werden kann. In § 372 (Ironie) färbt sich der Lehrer scheinbar mit der Schülermeinung ein, um dann in einem alles wendenden Moment diese Schülermeinung zu verraten, ihre Anmaßung zu enthüllen und ihr die Lehrermeinung entgegenzusetzen. In § 373 (Anmaßung) schließlich verweist Nietzsche auf das Paradox jeder Anmaßung: je stärker diese (scheinbar) die Umgebung mit ihrer eigenen Meinung einfärbt, umso sicherer wird sich darunter die Demütigung entwickeln, bis diese schließlich überhand nimmt und sich rächt. Wie die Ironie ihre Kraft nur aus dem Unterschied zwischen Lehrermeinung und Schülermeinung ziehen kann, so ist die Anmaßung in ihrer Kraft immer mit der Demütigung als Differenz verbunden.
Nietzsches Interpretation gilt also dem Spiel differenter Kräfte: solchen, die sich gleichzeitig eines Dinges bemächtigen, sei es in Kooperation, sei es im Konflikt, und solche, die das Spiel der Kräfte wandeln: die Anmaßung, aus der sich die Demütigung, aus der sich die Rache entwickelt.
Barthes hat dazu geschrieben (nachdem er sich mit Nietzsche und dem Nietzsche-Buch von Deleuze auseinandergesetzt hatte):
Einen Text interpretieren heißt nicht, ihm einen (mehr oder weniger begründeten, mehr oder weniger freien) Sinn geben, heißt vielmehr abschätzen, aus welchem Pluralem er gebildet ist. (Barthes: S/Z, S. 9)
(Das Wort «spöttisch» folgt dem Wort «verspottet», weil Gustave spürt, dass diese Wörter durch eine tiefe Verwandtschaft miteinander verbunden sind: der Spott wird gekränkt als dumme Verhöhnung verinnert und als erwiderte Verhöhnung rückentäußert. Der in den schulischen Wettkämpfen geschlagene kleine Junge sieht die Chance, seine Besieger auf einem anderen Feld zu besiegen: in den Pausen, im Schlafsaal, überall außer in der Klasse wird er sich durchsetzen; er wird den Preis in Bissigkeit, Ironie und Lästerei erhalten; da er im Namen des Konformismus verspottet wird, wird er vor den entsetzten Augen seiner Mitschüler den Konformismus entlarven. Er wird bösartig, beißend, beleidigend sein; der von seiner Körperkraft unterstützte schwarze Humor wird sie zwingen, in einem ständigen Skandal zu leben. (das nur als Beiwerk aus: Sartre, Flaubert II. Die Personalisation, S. 577) - im Übrigen gibt es einen ganzen Wortschwarm zur Bissigkeit bei Sartres Flaubert)
Nachsatz
Alice wollte wissen, was Sarkasmus ist und einen kurzen, erklärenden Text dazu haben. Den kann ich wohl nicht liefern.
Ich würde gerne von meinem Text folgendes sagen können: Ich bin dem Pluralen nachgegangen, der im Sarkasmus mitwirkt. Ich habe, auf sehr oberflächliche Weise, das Spiel von Kräften abgeschätzt, die im sarkastischen Reden und im Reden über den Sarkasmus wirksam sind.
Wie so oft, wenn man nicht die Interpretation mit der Definition verwechselt, endet die Interpretation mit einer gewissen Ermüdung.
Was ich noch so gefunden habe
Irene wurde oft zu Rendezvous eingeladen, aber sie schlug Einladungen gewöhnlich aus, weil sie jeglichen körperlichen Kontakt, sogar das Küssen, hasste. Es wurde ihr deutlich, dass ein Mann für sie nur interessant wurde, wenn er sich nicht von ihr angezogen fühlte, und dass sie ihrerseits anfing, sich von Männern abgestoßen zu fühlen oder sie zu verachten, sobald sie Interesse an ihr zeigten. Ihre hauptsächliche Art, mit Freunden, Männern oder Frauen, zu kommunizieren und auch Bemerkungen über sich selbst zu machen, war Sarkasmus - manchmal tatsächlich äußerst witzig und ulkig.
Sie besuchte unter großen Opfern das College und brauchte etwa 8 Jahre bis zu ihrem Abschluss, weil sie abwechselnd ein Semester zur Schule ging und ein Semester als Bedienung arbeiten musste. Zu ihrer Wut, ihrer Bitterkeit und ihrem Neid trug die Tatsache bei (was sie erst spät in ihrer Analyse zugeben konnte), dass sie das meiste ihres Verdienstes an Tony schicken musste, der auf diese Art die Universität absolvierte, obwohl er ständig in seinen Klausuren durchfiel und sein Geld auf Saufgelagen verschleuderte. Dennoch bestanden ihre Eltern darauf, dass "seine Ausbildung" Vorrang vor der ihren hatte.
Irenes Hauptinteresse auf dem College galt der Kunst. Sie wollte gerne Künstlerin werden und hatte größtes Interesse daran, als Illustratorin zu arbeiten. Ihre Studienberater am College jedoch rieten ihr, Lehrerin zu werden. Sie folgte dem Ratschlag, doch hasste sie diesen Beruf mit den Jahren zunehmend mehr. Hin und wieder zeichnete und malte sie noch, und ihre Freunde ermutigten sie, ihre Kunstwerke zu verkaufen, weil sie hervorragend waren. Aber sie verschenkte ihre Arbeiten, weil sie sie nicht für wertvoll genug erachtete, um verkauft zu werden.
Im Gegensatz zu ihrer vorwiegenden, drückenden Depression war sie oft (besonders in früheren Jahren) recht erfolgreich mit ihren Clownereien, denn sie hatte einen hervorragenden Sinn für das Komische in einer Situation, und sie kostete es voll aus: "Fröhlichkeit ist oft ein unbedachtes Wellenspiel über Tiefen der Verzweiflung" ("Gaiety is often the reckless ripple over depths of despair"). (aus einer psychoanalytischen Fallbeschreibung)
Sie hatte ungefähr die letzten sechs Monate damit verbracht, sich an die düstere Aussicht von dreißig oder sogar vierzig lieblosen Jahren zu gewöhnen, die ihr an der Seite dieses Mannes bevorstanden - dieses Mannes, der abwechselnd wütend auf sie war, sie mit kaltem Sarkasmus überschüttete oder sie überhaupt nicht zur Kenntnis nahm. Soweit es Danforth anging, war sie nur ein Möbelstück - es sei denn, natürlich, dass er etwas an ihr auszusetzen hatte. Wenn das der Fall war - wenn das Abendessen nicht auf dem Tisch stand, wenn er es haben wollte, wenn ihm der Fußboden in seinem Arbeitszimmer schmutzig vorkam, sogar wenn die Teile der Zeitung, die er zum Frühstück las, in der falschen Reihenfolge lagen -, dann nannte er sie dämlich. Erklärte ihr, wenn sie ihren Arsch verlöre, wüsste sie nicht, wo sie danach suchen sollte. Sagte, wenn Gehirn Schwarzpulver wäre, wäre sie nicht imstande, sich ohne Sprengkapsel die Nase zu putzen. Anfangs hatte sie versucht, sich gegen diese Tiraden zur Wehr zu setzen, aber er hieb ihre Verteidigung in Stücke, als handelte es sich um die Mauern einer Kinderburg aus Pappe. Wenn sie ihrerseits zornig wurde, dann übertraf er sie mit weißglühender Wut, die ihr Angst einjagte. Also hatte sie es aufgegeben, zornig zu werden, und war stattdessen in Tiefen der Bestürzung versunken. Neuerdings lächelte sie nur hilflos angesichts seiner Wut, versprach Besserung und ging in ihr Schlafzimmer, wo sie auf dem Bett lag und weinte und sich fragte, was aus ihr noch werden sollte. Sie wünschte sich, sie hätte eine Freundin, mit der sie reden konnte. (Stephen King, In einer kleinen Stadt)
Für Sherlock Holmes ist sie immer die eine, die ganz besondere Frau gewesen. Für ihn hatte sie immer den einen Namen, selten hat er sie anders genannt. In seinen Augen überragte sie alle anderen Frauen. Dabei war es gar nicht so, dass er ein Gefühl wie Liebe oder dergleichen für Irene Adler empfunden hätte. Alle Emotionen, und diese eine, die Liebe, ganz besonders, waren seinem kalten, exakten, aber bewundernswert ausgeglichenen Bewusstsein verhasst. Lassen Sie es mich so sagen: Er war perfekt, wenn es ums Argumentieren ging, er war die beste Beobachtungsmaschine, die die Welt je gesehen hat. Aber ein guter Liebhaber wäre er nie geworden. Niemals sprach er von romantischen Liebeshelden anders als mit Sarkasmus und Hohn. Romantische Gefühle waren das gefundene Fressen für den scharfen Beobachter, - bestens geeignet, den Schleier von den Motiven und Handlungen der Mitmenschen wegzuziehen und sie bloßzustellen. Aber selbst einen solchen Einbruch in das eigene, empfindliche, gut ausbalancierte Temperament zuzulassen hätte für den hochqualifizierten Denker höchstens Ablenkung bedeutet, die die geistige Arbeit störte. Sand im Getriebe oder ein Sprung in einer hochempfindlichen Linse konnten sich nicht störender auf eine Maschine auswirken als eine starke Emotion auf eine Natur wie die seine. (Beginn der Sherlock Holmes-Geschichte 'Skandal in Böhmen')
18.09.2006
"Ich biete hier allen ein Menü an ...
P.S.: Hassen Sie Privatwitze auch so wie ich?
14.09.2006
Thomas Hofmann schreibt:
Hallo lieber Kritiker, hier meldet sich kurz der “Gelegenheitszeichner“. Danke für die Erwähnung. Ist ja rührend, wie man so “da draußen“ wahr genommen und schnell und “kritisch“ abgebürstet wird.
Tatsächlich illustriere ich nur “gelegentlich“, weil das ein Hobby ist und mir im Grunde Spaß bereitet, so wie den Autoren das Schreiben (aber Dir beim Lesen leider weniger). Das ganze Buch ist, so nebenbei, sicher kein richtiges großverlegerisches Profi-Produkt. Vielleicht solltest Du das bei Deiner Bewertung berücksichtigen.
Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Hätte mir jemand das Buch gegeben und dazu geschrieben: Dies ist ein kleinverlegerisches Laienprodukt, dann hätte ich mir das Lesen vielleicht erspart und gesagt: Geben wir dem Ganzen doch mal ein Sternchen für Kleinverlegertum und Laienhaftigkeit.
Leider habe ich es gelesen und dann verzweifelt versucht, Minus-Sternchen zu geben. Gab's leider nicht.
Und glauben Sie mir, Herr Hofmann: Wenn ich eine Rezension schreibe, dann habe ich durchaus nur Vergnügen im Sinn, nämlich das Vergnügen zukünftiger Leser. Warum sollte ich also ein Buch empfehlen, das sprachlich ein Ärgernis, erzählerisch eine einzige Katastrophe ist?
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man in seinen eigenen Texten gerne Fehler übersieht. Dazu gibt es einen Verlag und ein Lektorat. Oft - nicht immer eben. Jedenfalls sollte der Autor ein wenig mehr als basale sprachliche Kompetenzen besitzen (und ein Verlag sollte das einzuschätzen wissen), und grundsätzlich sollte ein Autor in der Lage sein, eine Geschichte halbwegs zu erzählen.
Und was Ihre Bilder angeht, so habe ich doch Recht, wenn ich Sie als Gelegenheitszeichner bezeichne, oder? Ob man das nun als gut oder schlecht liest, liegt vielleicht auch an dem Umfeld, in dem Ihre Zeichnungen erscheinen. Für mich ist das immer noch ein recht neutraler Ausdruck. Bewerten wollte ich die zwei Zeichnungen auf jeden Fall nicht.
Herzlichst,
Frederik Weitz
Nachtrag vom 15.09.2006:
Ich habe mittlerweile die Fortsetzung rezensiert. Was die Erzählungen angeht, hat sich meine Meinung nicht geändert. Was die Zeichnungen angeht, schon: diese weisen einen flüssigeren Strich auf und wirken dadurch lebendiger. Sie sind realistisch gehalten und von der Komposition nicht schmerzhaft (für meinen Geschmack aber noch zu voll gepackt). Mehr verlange ich von einer Buchillustration eines Fantasy- oder Horror-Buchs nicht.
13.09.2006
"Donna Leon", sagt
12.09.2006
Humorvolle Geschichten
Die eine ist eher anekdotisch und ändert nichts am Zustand der Protagonisten. Paradebeispiel dafür ist Pippi Langstrumpf, in deren Leben sich nichts ändert. Der Humor entsteht hier aus der Widerständigkeit gegen die Sozialisation. (Diese Erklärung ist natürlich völlig trostlos.)
Die andere Form ist bedingt anekdotisch, hat aber eine Steigerung der Spannung in sich: hier wird ein Ziel gesetzt, das unter überraschenden Wendungen erreicht wird. Der Räuber Hotzenplotz gehört dazu und das erste Buch von Artemis Fowl. Hier ist der Trick einerseits, dass die Konfrontation mit dem Bösen recht früh anfängt und ohne lange Suche einsteigt, und dass sich der Protagonist entweder immer weiter von seinem Ziel entfernt - so bei Räuber Hotzenplotz -, oder die Bedrohungen immer absurder und gefährlicher werden - so bei Artemis Fowl.
Anekdotisch meint hier, dass in der Geschichte eine Art Kurzgeschichte auftaucht, die für sich stehen könnte. Sie ist lose mit der gesamten Geschichte über den gleichen Ort und/oder den gleichen Protagonisten gekoppelt.
Die Anekdote verträgt sich schlecht mit der Spannungsliteratur, es sei denn, diese ist humorvoll, ironisch oder zynisch. Die Krimis von Dürrenmatt und bestimmte seiner Dramen kann man dazu zählen. Bevorzugt man seichtere Gewässer, seien hier die Krimis von Camilleri wärmstens ans Herz gelegt.
Was, meiner Ansicht nach, garnicht geht, sind Krimis, bei denen der Humor auf unausgearbeitete Personen und auf einen schlecht konstruierten Plot trifft. Wahrscheinlich gehen solche Krimis auch dann nicht, wenn sie ohne Humor sind. Ich habe zum Glück schon lange keinen solchen mehr gelesen und mich in letzter Zeit viel an die Klassiker gehalten. Einen unmöglichen Krimi mit schlechtem Humor finden sie hier. Dieser Krimi ist ermüdend und peinlich. Nur weil ich eine Rezension darüber schreibe, habe ich ihn zu Ende gelesen.
Dass die Anekdote nicht in den besseren Krimis vorkommt (oder wenn, dann nur sehr selten), liegt im Übrigen nicht daran, dass es Schlag auf Schlag geht. Liest man sich Hammetts Malteser Falken durch, stellt man fest, dass er sich viel Zeit lässt und die einzelne Szenen eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Geschichte bewahren. Hier ist aber die Kunst Hammetts zu würdigen, bei dem Szenen in sich etwas bedeuten, und trotzdem vollständig in den gesamten Plot eingefügt sind. Die Für-Sich-Bedeutsamkeit einer Szene macht eben noch nicht die Anekdote aus, sondern vor allem den hervorragenden Autor. - Auch Camilleri kann das ordentlich. Trotzdem gebe ich auch Hammett eindeutig den Vorzug. Bei Donna Leon sucht man hier eher vergeblich. Dass ihre Szenen etwas anekdotenhaftes haben, liegt an einer mangelnden Verknüpfung, nicht an dem gewollten und bedeutsamen Auskleiden. Ihre Plots sind nett, aber insgesamt langweilt sie mich. Martha Grimes dagegen sitzt bei ihren Szenen nicht nur der Schalk im Nacken, sondern auch ein profunde durchdachtes Handwerk im Kopf. Krimis wie "Fremde Federn" oder "Inspektor Jury geht übers Moor" drehen und wenden und biegen sich sehr leicht um den Fall herum, wurzeln aber trotzdem sicher in diesem Nährboden der Spannung.
Bei Grimes scheint ein starkes Mittel des Humors (aber ich habe das nie genauer untersucht) der Kontrast von Personen und Lebensstilen zu sein. Diese Personen und Lebensstile geraten aneinander und missverstehen sich, ohne dass den Figuren das bewusst zu werden scheint, während der Leser dies ganz klar erfasst. Diese Befangenheiten haben durchaus Ähnlichkeiten mit psychologisch verfeinerten Pippi Langstrumpfens.
Während bei Pippi Langstrumpf die Sozialisation von vorneherein verweigert zu werden scheint, sind die skurrilen Gestalten bei Grimes Menschen, die aus ihrer Sozialisation in einen gewissen Unwillen zur Sozialisation gekippt sind. Bei Artemis Fowl ist dies ähnlich. Die Beharrlichkeit, mit der Fowl sich an seinen Charaktereigenschaften festhält, wird von Colfer durch eine insgesamt unbestimmt gehaltene Sozialisation erklärt, aus der dann die Zielstrebigkeit oder Dickköpfigkeit resultiert, die zugleich etwas Geniales an sich hat, aber auch an das Trotzverhalten eines Vierjährigen erinnert. Vielleicht ist mir deshalb die Figur so sympathisch.
10.09.2006
Why Am I Famous?
 Die Arbeiten haben, wie hier nebenstehend, einen guten Sinn für Humor. Besonders schön finde ich seine zugleich sehr witzigen wie politischen Arbeiten auf der Westbank / Palästina. Ohne zu beleidigen klagen diese eine unwürdige Situation an, sind so provokativ wie einfallsreich, so schlicht in ihrer Ausdrucksweise wie komplex in ihrer Wirkung.
Ich bin sehr begeistert.
Die Arbeiten haben, wie hier nebenstehend, einen guten Sinn für Humor. Besonders schön finde ich seine zugleich sehr witzigen wie politischen Arbeiten auf der Westbank / Palästina. Ohne zu beleidigen klagen diese eine unwürdige Situation an, sind so provokativ wie einfallsreich, so schlicht in ihrer Ausdrucksweise wie komplex in ihrer Wirkung.
Ich bin sehr begeistert. Die Gemälde, die Banksy gemalt hat, zeigen ebenfalls sehr unterschiedliche Themen, wie hier die Umweltverschmutzung auf einem Wasserlilien-Gemälde von der japanischen Brücke in Monets Garten, oder Spekulationsgeschäfte in den Idyllen klassischer englischer Maler.
Eine besondere Form der Kunstaktion ist das museum-bashing, in der seltsame Objekte in Museen abgelegt werden (siehe unten). Zu einer ähnlichen Aktion existiert auch ein wundervoller Video-Film, den man sich auf der Homepage des Künstlers anschauen kann.
Die Gemälde, die Banksy gemalt hat, zeigen ebenfalls sehr unterschiedliche Themen, wie hier die Umweltverschmutzung auf einem Wasserlilien-Gemälde von der japanischen Brücke in Monets Garten, oder Spekulationsgeschäfte in den Idyllen klassischer englischer Maler.
Eine besondere Form der Kunstaktion ist das museum-bashing, in der seltsame Objekte in Museen abgelegt werden (siehe unten). Zu einer ähnlichen Aktion existiert auch ein wundervoller Video-Film, den man sich auf der Homepage des Künstlers anschauen kann.
09.09.2006
Ach, Ovid ...
Ich: Der hat sich in sein Spiegelbild verliebt und zunächst ...
Er: Eben nicht; das war ein Mensch, der die Liebe anderer Menschen nicht erwidern konnte.
Ich: Na, bei Ovid steht aber ...
Er: Ach, Ovid, der hat doch schon seit Jahren nichts Gutes mehr geschrieben.
07.09.2006
Geschichten schreiben
Rohfassungen
Drei Sachen solltest du allerdings unterscheiden:
1.) zuerst muss sich der Autor über die Geschichte klar werden (dazu gibt es solche Rohfassungen)
2.) dann solltest du planen, wie du den Leser in die Geschichte einführst und
3.) was du die Protagonisten entdecken lässt.
1.) Über die Geschichte klar werden
Was mich mehr und mehr an kreativen Schreibspielen gestört hat, waren die vielen wolkigen Produkte, die ich mir dort zusammengebastelt habe, oder auch, das habe ich mal in recht krasser Form erlebt, die vollständige Ablehnung von Planung. Im entsprechenden Jargon hieß das dann, dass man aus dem Bauch heraus schreiben solle, und all dies wurde damit begründet, dass es ein kollektives Unterbewusstsein à la C. G. Jung gäbe, das schon die passenden, bedeutungsvollen Symbole an die richtige Stelle setzen werde. Völliger Schwachsinn, wenn mich jemand fragen sollte.
Kreative Schreibspiele sollten erst in der nächsten Phase der Planung eingesetzt werden, wenn es um Feinarbeiten geht.
Gerüste – Schemata (und etwas zur humoristischen Literatur)
Davon kann man abweichen. Aber selbst so experimentelle Texte wie Arno Schmidts Gelehrtenrepublik und Elfriede Jelineks Lust folgen dem. Formelhaftes Schreiben ist deshalb – zunächst – nichts Schlechtes: Stephen King, der auch dieses Schema benutzt, hat nicht wirklich viel mit Arno Schmidt zu tun, oder?
Andererseits begeht Eoin Colfer in seinem Buch Artemis Fowl genau diesen Bruch: er beginnt nicht am Anfang, sondern eigentlich mitten in der Verwicklung, dort, wo Artemis im Prinzip die Lösung seines Problems schon erarbeitet hat. Trotzdem kann man nicht sagen, dass Colfer hochexperimentell schreibt. Die Abweichung vom klassischen Schema scheint mir insgesamt eher typisch für humoristische als für experimentelle Romane zu sein (humoristisch hier übrigens in allen Spielarten: von weichgespülter Humorliteratur bis hin zum beißenden politischen Spott).
Auffüllen
Für mich sind derzeit all jene Ereignisse am wichtigsten, die ich Hindernisse und Verfolgungen nenne.
Hindernisse
Verfolgungen
Diese Definitionen sollte man insgesamt nicht allzu ernst nehmen. Jedenfalls dienen sie mir dazu, meine Ideen zum Mittelteil zu ordnen.
2.) Den Leser in die Geschichte führen
Wohlfühlen
Der erste Satz
Stephen King beginnt seinen Roman Es mit folgendem Satz: "Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte – wenn er überhaupt je ein Ende nahm -, begann, soviel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlang trieb."
Nehmen wir diesen ersten Satz auseinander: "Der Schrecken," – das Thema wird abstrakt gesetzt: der Leser weiß noch nicht, welcher Schrecken, aber der Konflikt ist mit diesem Wort bereits da – "der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte" – eine Ankündigung, die den Zeitraum, in dem die Handlung spielt, klarstellt – "- wenn er überhaupt je ein Ende nahm -," – und, als eine Art Gegenargument wird die Klarstellung sofort in Zweifel gezogen – "begann," – Markieren des Anfangs der Handlung – "soviel ich weiß und sagen kann," – der Erzähler beschränkt sich selbst (das ist bei Stephen King, der immer auktorial erzählt, zunächst überraschend, passt aber erstens zum vorher angesprochenen Zweifel, zweitens aber dazu, dass King seine Informationen während des Romans nie vollständig hergibt: er ist nur in dem Maße auktorial, wie es ihm passt) – "mit einem Boot aus Zeitungspapier, ..." – der letzte Teil des Satzes liefert eine kleine Szene, die sehr idyllisch wirkt: setzt man sie zu dem Anfang des Satzes in einen logischen Bezug: (abstrakter) Schrecken – (konkrete) Idylle, bildet sich ein doppelter Kontrast. Spätestens ab hier ist der Leser darauf vorbereitet, dass ihn dieses kleine Boot mitten in den Schrecken hineinführen wird. Stephen King enttäuscht seine Leser nicht.
"Kaum war ihr Baby auf der Welt, merkten Mr und Mrs Canker, dass es anders war als andere Babys." (Eva Ibbotson, Das Geheimnis der siebten Hexe) – auch hier: die abstrakte Thematisierung: das Anders-sein.
"Es war um die Mittagszeit eines sehr heißen Junitags, als der »Dogfish«, einer der größten Passagier- und Güterdampfer des Arkansas, mit seinen mächtigen Schaufelrädern die Fluten des Stromes peitschte." (Karl May, Der Schatz im Silbersee) – May eröffnet mit einem konkreten Datum: der erste Teil des Satzes ist die klassische Einleitung einer Anekdote, während der zweite Teil des Satzes die Form der Anekdote in dem Sinne zurücknimmt, dass nicht direkt auf einen bestimmten Menschen gezielt wird, sondern zunächst nur auf den Ort und die besonderen Umstände des Ortes. Einige der schönsten Formen der Anekdote kann man bei Heinrich von Kleist studieren. Ich gebe hier ein paar Beispiele: "Ein H...r Stadtsoldat hatte vor gar nicht langer Zeit, ohne Erlaubnis seines Offiziers, die Stadtwache verlassen." (Der verlegene Magistrat); "In Polen war eine Gräfin von P..., eine bejahrte Dame, die ein sehr bösartiges Leben führte, und besonders ihre Untergebenen, durch ihren Geiz und ihre Grausamkeit, bis auf das Blut quälte." (Der Griffel Gottes); "Ein Kapuziner begleitete einen Schwaben bei sehr regnichtem Wetter zum Galgen." (Anekdote); "Zu St. Omer im nördlichen Frankreich ereignete sich im Jahr 1803 ein merkwürdiger Vorfall." (Mutterliebe)
Die Welt
Gleich vorneweg kann ich sagen: junge Autoren neigen zu langschweifigen, überblickenden Prologen. Die sollte man dringend streichen. Solche Prologe sind der meist unzureichende Versuch, sich eine Geschichte zu erarbeiten. Die schreibt der Autor für sich selbst, und da er gleichzeitig meint, für den Leser zu schreiben, bleibt er im Prolog auch noch unklar – damit es irgendwie spannend sei. Dadurch aber wird der Prolog an sich unklar.
Man kann immer noch, auch später, neue Aspekte einführen, neue Bereiche der Welt. Zu Beginn einer Geschichte ist es wichtig, den Ort und einige Personen, die für den Protagonisten zentral bedeutsam sind, gut zu charakterisieren. Alles weitere kann nach hinten hinaus geschoben werden. Freilich gibt es hier die Technik des "zooming-in": diese führt vom Großen zum Kleinen, wird aber heute nicht mehr in dem Maße gebraucht, wie dies früher der Fall war. Hervorragende erste generelle Sätze findet man z.B. bei John Steinbeck, "Früchte des Zorns"; Heinrich von Kleist, "Die Verlobung in St. Domingo"; Lion Feuchtwanger, "Jud Süß"; Joseph Roth, "Radetzkymarsch".
Ich mag hier nicht einen ganzen Roman auseinander nehmen, um zu zeigen, dass die Welt nicht nur zu Beginn erschlossen wird. Das kann man selber studieren: Achten sollte man dabei auf das typische Mittel der Beschreibung und wo dieses angewendet wird. In älteren Romanen steht dies oft zu Beginn von neuen Abschnitten, in neueren Romanen häufiger mittendrin. Hervorragende Geschichten in der Geschichte, die jeweils neu anfangen und sich so in die gesamte Geschichte einlagern, findet man z.B. in Stephen Kings "Es".
Identifikation
Obwohl also zu Beginn auch möglichst der Gesamtkonflikt oder zumindest ein Teil des Gesamtkonfliktes klar gemacht werden sollte, müssen hier auch Markierungen und Orientierungen für den Leser gesetzt werden, die "alltäglich" sind und die der Leser gut nachvollziehen kann. Kings sehr sinnliche Beschreibung eines spielenden Kindes zu Beginn von "Es" leistet dies, und insgesamt sollten die ersten Szenen sinnlich sein. Zu Beginn des "Räuber Hotzenplotz" wird, in knappen Worten, eine Idylle beschrieben: Großmutter beim Kaffeemahlen. Obwohl hier nicht der erste Satz in den Konflikt hineinspringt, ist der Konflikt in dieser Idylle vorstrukturiert: Kasperl und Seppel haben Großmutter eine besondere Kaffeemühle geschenkt, und diese Kaffeemühle wird ihr gleich geraubt.
Karl May beginnt seine Roman-Trilogie "Satan und Ischariot" mit den Worten: "Sollte mich jemand fragen, ..." und fährt später fort: "Diese Meinung ist allerdings nur eine rein persönliche, ...", wobei die Identifikation gerade dadurch gewährleistet wird, indem eine absolute Sichtweise abgelehnt wird. Der mögliche Kontrast macht die Perspektive glaubwürdig und setzt den ersten Konflikt (der traurigste, langweiligste Ort der Erde).
Drei Techniken also der Identifikation (es gibt natürlich noch mehr):
- abstrakte Ankündigung des Konfliktes und sinnlich-konkreter Kontrast (Stephen King und Gabriel Garcia Marquez),
- idyllische Anfangsszene, in der der Konflikt im Wesentlichen aber seine Elemente geliefert bekommt (die Kaffeemühle im Hotzenplotz),
- das Thematisieren der Perspektive (z.B. auch in Kings Roman "In einer kleinen Stadt").
3.) Den Protagonisten in die Welt einführen
Stattdessen acht Tipps:
1. Tipp: Welchen Konflikt sprichst du an? - Schreibe dir diesen zentralen Konflikt auf und versuche dazu einen ersten, spannenden Satz zu finden (Zusatz-Tipp: Klau ihn aus einem anderen Buch! Ich klaue auch immer meine ersten Sätze.)
2. Tipp: Schreibe dir von jedem der Personen drei Eigenschaften, drei gern getane Tätigkeiten und drei ungern getane Tätigkeiten auf. - Schreibe dann dazu auf, ob die Person diese Eigenschaft mag und warum er sich mag oder nicht mag. Bei den Tätigkeiten schreibst du einfach auf, warum er sie mag oder nicht mag (also eine Begründung!!!). - Ganz wichtig dabei: Lass jede Person den Satz selber sprechen, also in wörtlicher Rede.
3. Tipp: Dann denkst du dir noch zu den Eigenschaften und Tätigkeiten aus, wie die wichtige Personen aus der Umgebung (also z.B. Eltern, wenn die Protagonisten Kinder sind) diese sehen. - Hier spielst du ein wenig herum, so dass die Eltern (oder andere) nicht dasselbe denken, wie die Kinder (Protagonisten). - Zentral dabei ist, dass du so Konflikte erfindest: das eine Kind z.B. mag gerne Computerspielen, weil er ...; die Mutter hat mal gelesen, dass Computerspiele nervös machen, und macht sich deshalb Sorgen um ihr Kind.
4. Tipp: Begründe für dich selbst, warum die Fähigkeiten und die Tätigkeiten in der Geschichte wichtig werden könnten oder wichtig sind. - Auch hier darfst und solltest du zunächst ohne Rücksicht auf deine tatsächliche Geschichte begründen: zentral ist, dass sie wichtig sein könnten, nicht das sie ernsthaft wichtig werden.
5. Tipp: Schreibe dir alle möglichen Situationen zu deiner Geschichte auf! Wie sieht eine allerkürzeste Situation aus? Ich mache das folgendermaßen:
Bezeichnung: stichwortartig, was in dieser Szene passiert
Anfangssituation: ebenfalls stichwortartig
Handlung: ebenfalls stichwortartig, - ich setze die Handlung oder Handlungen einfach hintereinander, - bedenke bitte, dass Handlung heißen kann: verbale Handlung (also Dialog) oder non-verbale Handlung (also action, action, action, wie z.B. einer Großmutter über die Straße helfen) – die Handlung führt die Bezeichnung genauer aus
Resultat: was bei der Szene herauskommt - auch hier: erstens ist eine neue Information auch ein Resultat, zweitens ist auch eine falsche neue Information ein Resultat, drittens: auch kein Resultat ist ein Resultat: man hat gedacht, der Höhleneingang führte in das Feenreich, aber er endet schon nach einigen Metern: das Resultat besteht hier in der Information
6. Tipp: Szenen ordnen! - lassen sich Szenen dicht nebeneinanderstellen oder bauen sie sogar aufeinander auf? kannst du Szenen zu einer Abfolge zusammenfassen? wenn ja: fasse sie zusammen und gib der Abfolge einen eigenen Namen
7. Tipp: Nimm nicht alles wortwörtlich, was dir hier gewisse Menschen wie meinereiner so sagen; Schreiben ist zwar viel Handwerk, aber eben doch ein kreatives Handwerk: wie du die Tipps für dich selbst verwenden kannst, kannst nur du selbst herausfinden.
8. Tipp: immer hübsch aus anderen Büchern klauen! - Was du bei anderen Autoren gut findest, solltest du zumindest ausprobieren. Schreiben ist nicht nur Handwerk, Schreiben ist auch das Arbeiten mit Klischees. Und: Bei vielen Autoren besteht die Suppe aus Wasser mit einer Erbse: schreib einfach so, dass in deiner Suppe eine zweite Erbse, eine Karotte und etwas Petersilie zu finden ist. Dann wirds schon ein Bestseller! (allerdings gibt's dann eine saftige Rechnung von mir für diese Tipps)